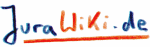zurück: ../GründeB
Die Anträge sind unbegründet. Die Anordnungen des Bundespräsidenten vom 21. Juli 2005, den 15. Deutschen Bundestag aufzulösen und die Wahl auf den 18. September 2005 festzusetzen, verstoßen nicht gegen das Grundgesetz. Sie verletzen oder gefährden die Antragsteller deshalb nicht in ihrem durch Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GG geschützten Status als Abgeordnete des Deutschen Bundestages.
- 127
I.
1. Inhaltlicher Prüfung in den vorliegenden Verfahren bedarf nur die Anordnung des Bundespräsidenten, den Deutschen Bundestag aufzulösen. Gründe dafür, dass die sich als Folge aus der Auflösung ergebende Festsetzung der Wahl (Art. 39 Abs. 1 Satz 4 GG) daneben selbstständig verfassungswidrig in die Rechte der Antragsteller eingreifen könnte, sind nicht ersichtlich und von den Antragstellern auch nicht geltend gemacht worden (vgl.BVerfGE 62, 1 <34>).
- 128
Die Auflösungsanordnung des Bundespräsidenten stützt sich auf Art. 68 GG. Danach kann auf Antrag des Bundeskanzlers der Bundespräsident den Bundestag auflösen, wenn ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages gefunden hat. Der Bundespräsident trifft die Entscheidung, den Bundestag aufzulösen oder aber dem Antrag des Bundeskanzlers nicht Folge zu leisten, als politische Leitentscheidung in eigener Verantwortung. Diese Entscheidung obliegt dem pflichtgemäßen Ermessen des Bundespräsidenten. Ein Ermessen im Rahmen des Art. 68 GG ist dem Bundespräsidenten allerdings nur eröffnet, wenn im Zeitpunkt seiner Entscheidung die Voraussetzungen des Art. 68 GG erfüllt sind (vgl.BVerfGE 62, 1 <35>).
- 129
Es bedarf keiner abschließenden Entscheidung, ob der Bundespräsident über eine Evidenzkontrolle hinaus verpflichtet ist, die Einhaltung dieser verfassungsrechtlichen Anforderungen vor seiner Entscheidung zu prüfen. Das Bundesverfassungsgericht kann im Organstreitverfahren mit dem Ziel angerufen werden, die Beachtung von Art. 68 GG zu überprüfen. Kommt eine verfassungsgerichtliche Überprüfung zu dem Ergebnis, dass die Tatbestandserfordernisse des Art. 68 GG nicht erfüllt sind, ist die Auflösung des Deutschen Bundestages verfassungswidrig (BVerfGE 62, 1 <36>).
- 130
2. Der verfassungsrechtliche Prüfungsmaßstab folgt aus Art. 38 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 39 Abs. 1 Satz 1 und Art. 68 GG. Die antragstellenden Abgeordneten berufen sich auf ihren Status als gewählte Vertreter des Volkes. Nach Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GG sind sie für die Dauer von vier Jahren gewählt. Die Auflösung des Deutschen Bundestages vor Ablauf dieser Wahlperiode greift in ihren Status als Abgeordnete ein und ist nur gerechtfertigt, wenn das Grundgesetz dies erlaubt. Der Eingriff in Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG beschränkt sich jedoch nicht allein auf die vorzeitige Beendigung des Abgeordnetenmandats. Die mögliche Auflösung des Deutschen Bundestages kann sich auch mittelbar auf den Status des Abgeordneten auswirken, weil die Stellung des Abgeordneten im politischen Gefüge geschwächt wird, wenn diese Möglichkeit ohne weiteres realisiert werden kann.
- 131
II.
Die auf Auflösung des Bundestages gerichtete Vertrauensfrage ist nur dann verfassungsgemäß, wenn sie nicht nur den formellen Anforderungen, sondern auch dem Zweck des Art. 68 GG entspricht.
- 132
Das Grundgesetz erstrebt mit Art. 63, Art. 67 und Art. 68 eine handlungsfähige Regierung. Handlungsfähigkeit bedeutet nicht nur, dass der Bundeskanzler mit politischem Gestaltungswillen die Richtlinien der Politik bestimmt und dafür die Verantwortung trägt (Art. 65 Satz 1 GG), sondern hierfür auch eine Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages hinter sich weiß (1.). Das Grundgesetz enthält besondere Vorschriften, um in einer politischen Krise notfalls auch eine Minderheitsregierung handlungsfähig zu halten. In erster Linie bietet es jedoch Auswege, die auf die Wiederherstellung stabiler Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag gerichtet sind (2.). Die auf Auflösung gerichtete Vertrauensfrage ist als eine dem Zweck des Art. 68 GG entsprechende Maßnahme gerechtfertigt, wenn sie der Wiederherstellung einer ausreichend parlamentarisch verankerten Bundesregierung dient (3.). Das Bundesverfassungsgericht prüft die zweckgerechte Anwendung des Art. 68 GG nur in dem von der Verfassung vorgesehenen eingeschränkten Umfang (4.).
- 133
1. Die Verfassung zielt auf eine parlamentarisch verankerte Regierung. Der Bundeskanzler wird vom Bundestag gewählt (Art. 63 GG). Für eine effektive Wahrnehmung seines dadurch errungenen politischen Gestaltungsmandats bedarf er kontinuierlicher Unterstützung durch die Mehrheit des Deutschen Bundestages. Gestützt auf sein freies Mandat ist allerdings jeder Abgeordnete berechtigt und dafür verantwortlich, die Regierung zu überwachen und im Rahmen der Kompetenzen des Bundestages die Politik mit zu gestalten. Die Aufgabe der Kontrolle fällt dabei zwar in besonderem Maße, aber keineswegs ausschließlich, der Opposition im Bundestag zu (vgl. Schneider, Die parlamentarische Opposition im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 1974, S. 236 ff.). Vor allem in der parlamentarischen Debatte begleitet die Opposition das Regierungshandeln kritisch und formuliert Alternativen öffentlich. Die Mehrheit, aus der heraus der Kanzler gewählt wurde, wird dagegen typischerweise gerade in offenen Debatten "ihre" Regierung und "ihren" Kanzler unterstützen, während sie gleichwohl bestehende Kritik am politischen Kurs der Regierung regelmäßig lediglich fraktions- oder parteiintern äußern wird. In diesem Verhältnis zwischen der Regierung und einer ihr personell und sachlich verbundenen Parlamentsmehrheit einerseits und der in Opposition zur Regierung stehenden parlamentarischen Minderheit andererseits entfaltet sich der parlamentarische Willensbildungsprozess. Dieser Prozess wird durch Fraktionen im Bundestag maßgeblich geformt und gestaltet (vgl.BVerfGE 10, 4 <14>; 20, 56 <104>; 43, 142 <147>; 70, 324 <362 f.>; 84, 304 <324> ). Dies schließt öffentliche Kritik von Abgeordneten der Regierungsmehrheit ebenso wenig aus wie die freie Entscheidung des nur seinem Gewissen unterworfenen Abgeordneten. Der Bundeskanzler ist aber regelmäßig in besonderem Maße auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem oder den Fraktionsvorsitzenden der ihn tragenden Mehrheit im Parlament angewiesen. Die Führung der Fraktion wird darauf hinwirken, dass aus der Freiheit des Mandats ein wirksamer und ein einheitlicher Wille wächst, der im Fall der die Regierung unterstützenden Fraktionen mit der Konzeption der Bundesregierung vereinbar ist.
- 134
Grundsätzlich bedürfen der Bundeskanzler und seine Regierung einer verlässlichen parlamentarischen Mehrheit. Verlässlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Kanzler für das von ihm vertretene politische Konzept eine prinzipielle und ausreichende parlamentarische Unterstützung erwarten darf. Ob der Kanzler über diese verlässliche Unterstützung verfügt, kann von außen nur teilweise beurteilt werden. Aus den parlamentarischen und politischen Arbeitsbedingungen kann sich ergeben, dass der Öffentlichkeit teilweise verborgen bleibt, wie sich das Verhältnis des Bundeskanzlers zu den seine Politik tragenden Fraktionen entwickelt. Es muss nicht offen und nicht eindeutig zu Tage treten, ob der Kanzler und seine Regierung noch über eine verlässliche parlamentarische Mehrheit verfügen.
- 135
2. Vermag der Bundeskanzler nicht (mehr) die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages auf sich zu vereinigen, wird seine Lage vom Grundgesetz als politische Krise eingestuft und mittels besonderer Vorschriften erfasst, die auch andere Verfassungsorgane in die Verantwortung einbeziehen (Art. 63 Abs. 4 Satz 3, Art. 81 GG; vgl. auch Art. 111 GG). Mit Billigung des Bundespräsidenten soll auch ein Minderheitskanzler ernannt werden können, und eine Regierung kann handlungsfähig gehalten werden, indem die Möglichkeit eingeräumt wird, ohne Mitwirkung des Deutschen Bundestages unentbehrliche Maßnahmen zu treffen und Gesetze zu erlassen (vgl. Badura, Vorkehrungen der Verfassung für Not- und Krisenlagen, ThürVBl 1994, S. 169 <174 f.>).
- 136
Doch dies sind nur Sicherungsmaßnahmen. Grundsätzlich stellt das Grundgesetz solche Auswege aus einer parlamentarischen Krise bereit, die auf die Wiederherstellung der Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag gerichtet sind. Dabei handelt es sich um den Rücktritt und die Neuwahl eines Kanzlers gemäß Art. 63 GG, die Neuwahl eines anderen Kanzlers in Form des konstruktiven Misstrauensvotums gemäß Art. 67 GG und um die Vertrauensfrage des Kanzlers gemäß Art. 68 GG. Art. 68 GG umfasst nicht nur die nicht auflösungsgerichtete (so genannte echte) Vertrauensfrage, durch die eine in Zweifel stehende Handlungsfähigkeit hinsichtlich der tatsächlichen Kräfteverhältnisse im Parlament auf die Probe gestellt werden kann; auch die auflösungsgerichtete (so genannte unechte) Vertrauensfrage gehört danach zu den Instrumenten, die das Grundgesetz den Verfassungsorganen zur Verfügung stellt, um eine handlungsfähige Regierung mit hinreichender parlamentarischer Mehrheit zu sichern oder wieder zu gewinnen. Schon nach seinem systematischen Zusammenhang mit Art. 62 und Art. 67 GG gibt Art. 68 GG dem Bundeskanzler allerdings kein Mittel in die Hand, gemeinsam mit einer ihn verlässlich tragenden Parlamentsmehrheit einen ihm geeignet erscheinenden Neuwahltermin voraussetzungslos zu bestimmen (BVerfGE 62, 1 <42 f.>).
- 137
3. Die Auflösung des Deutschen Bundestages ist ein Eingriff in die Freiheit eines von Verfassungs wegen auf vier Jahre sich erstreckenden Abgeordnetenmandats (Art. 38 Abs. 1 Satz 2, Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GG). Ihre Rechtfertigung durch Art. 68 GG findet Grenzen im Zweck dieser Norm. Danach genügt die berechtigte Einschätzung des Bundeskanzlers, die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung im Hinblick auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sei beeinträchtigt.
- 138
a) Die Verkürzung der Wahlperiode kann das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie beeinträchtigen. Die Stabilitätsausrichtung des Grundgesetzes ist eine Antwort auch auf die Erfahrungen mit vorgezogenen Parlamentswahlen in der Weimarer Republik, die den Mitgliedern des Parlamentarischen Rates bei der Ausarbeitung des Grundgesetzes teilweise noch aus eigener Anschauung vor Augen standen. Wie die vorgezogene Reichstagswahl des Jahres 1928 zeigte, richteten vorgezogene Neuwahlen in einer Zeit relativer wirtschaftlicher und politischer Stabilität auch im politischen System der Weimarer Republik keinen Schaden an.
- 139
Die Auflösung des Reichstages, die nach dem Rücktritt der Regierung Müller vom Reichspräsidenten am 18. Juli 1930 angeordnet wurde, zerstörte demgegenüber eine parlamentarische Konstellation, in der die Parteien des Weimarer Verfassungsbogens eine solide Mehrheit besaßen. In der vorgezogenen Wahl des Jahres 1930 erreichten die Nationalsozialisten 18,3 %, und die KPD verbesserte ihr Ergebnis von 10,6 % auf 13,1 %, während alle anderen Parteien verloren. Die Fraktion der Sozialdemokraten tolerierte im radikalisierten Reichstag - um Schlimmeres zu verhüten - die Regierung Brüning bis zu ihrem Sturz am 30. Mai 1932. Mit der wiederum vorzeitigen Auflösung des Reichstages vom 4. Juni 1932 erfüllte der Reichspräsident nunmehr schon politische Forderungen der Nationalsozialisten, die dies zur Voraussetzung einer Tolerierung des neuen Kabinetts unter von Papen machten. Die vorgezogene Neuwahl vom 31. Juli 1932 machte dann parlamentarisches Regieren praktisch unmöglich, weil Nationalsozialisten und Kommunisten über 50 % der Stimmen und auch der Mandate erreicht hatten (vgl. Winkler, Der lange Weg nach Westen, 4. Aufl. 2002, Bd. 1, S. 484 bis 491).
- 140
Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates konnten aus dieser Entwicklung den Schluss ziehen, dass rasch hintereinander folgende Parlamentswahlen in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Krisen radikale Kräfte begünstigen und das allgemeine Vertrauen in die Regelhaftigkeit der politischen Willensbildung im Verfassungsstaat untergraben können.
- 141
b) Die Entstehungsgeschichte des Art. 68 GG bestätigt, dass die auflösungsgerichtete Vertrauensfrage nur dann gerechtfertigt sein soll, wenn die Handlungsfähigkeit einer parlamentarisch verankerten Bundesregierung verloren gegangen ist. Der Verfassungsgesetzgeber sah die Möglichkeit, dass es zum amtierenden Bundeskanzler aus dem Parlament heraus einerseits keine personelle Alternative für den Weg des Art. 67 GG gibt, der Kanzler aber andererseits für seine Politik auch keine hinreichende Unterstützung einer Mehrheit mehr findet. Der Organisationsausschuss des Parlamentarischen Rates hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 1948 das verfassungsrechtliche Problem einer solchen Konstellation gerade darin gesehen, dass der Kanzler diese Lage nicht aus eigener Initiative beendet, und zwar durch den Weg über eine Vertrauensfrage, um zu Neuwahlen zu gelangen. Als Problem wurde insofern, der an "seinem Stuhl klebende" Bundeskanzler gesehen, der im Amt bleibt, obwohl seine Handlungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Der für die geltende Fassung des Art. 68 GG verantwortliche Organisationsausschuss sah lediglich diejenige Gefahr als noch größer an, dass der Bundestag gegen den Willen des Bundeskanzlers über ein nicht konstruktives Misstrauensvotum zu einer Neuwahl gelangen kann. Ein entsprechender Vorschlag des Redaktionsausschusses wurde deshalb aus dem Entwurf des Grundgesetzes gestrichen (Parlamentarischer Rat, Organisationsausschuss, 28. Sitzung vom 16. Dezember 1948, S. 18 bis 22; siehe auch von Mangoldt, Die Auflösung des Bundestages, DÖV 1950, S. 697 ff.). Eine Lage der Instabilität zwischen Bundeskanzler und Deutschem Bundestag kann vor diesem Hintergrund nachhaltig nur beendet werden durch den Rücktritt des Kanzlers oder aber durch eine auflösungsgerichtete Vertrauensfrage.
- 142
Danach ist es gemessen am Sinn des Art. 68 GG nicht zweckwidrig, wenn ein Kanzler, dem Niederlagen im Parlament erst bei künftigen Abstimmungen drohen, bereits eine auflösungsgerichtete Vertrauensfrage stellt. Denn die Handlungsfähigkeit geht auch dann verloren, wenn der Kanzler zur Vermeidung offenen Zustimmungsverlusts im Bundestag gezwungen ist, von wesentlichen Inhalten seines politischen Konzepts abzurücken und eine andere Politik zu verfolgen. Der Kanzler muss zwar unter der Kontrolle und unter Mitwirkung des Bundestages handeln und sich insofern um den alltäglichen Kompromiss bemühen. Die Verfassung sieht die Regierung aber auch nicht als einen exekutiven Ausschuss des Parlamentes an. Voraussetzung für eine effektive gegenseitige Kontrolle der Gewalten ist, dass auch die Bundesregierung einen abgegrenzten Verantwortungsbereich hat (Art. 65 Satz 1 und 2 GG). Die Bundesregierung ist als eigenständiges politisch gestaltendes Verfassungsorgan konzipiert, das Verantwortung vor dem Deutschen Bundestag und vor den Bürgern nur übernehmen kann, wenn es im Rahmen der Kompetenzordnung über ausreichende eigenständige politische Handlungsspielräume verfügt.
- 143
Von Verfassungs wegen ist der Bundeskanzler in einer Situation der zweifelhaften Mehrheit im Bundestag weder zum Rücktritt verpflichtet noch zu Maßnahmen, mit denen der politische Dissens in der die Regierung tragenden Mehrheit im Parlament offenbar würde. Im Fall eines Rücktritts bliebe offen, ob dies zu stabileren parlamentarischen Verhältnissen führte; so wäre es schon ungewiss, ob die Wahl eines neuen Mehrheitskanzlers gemäß Art. 63 GG gelänge. Eine Pflicht des Bundeskanzlers, den politischen Dissens im Parlament offenkundig zu machen, könnte die vom Grundgesetz erstrebte politische Stabilität zusätzlich erschüttern. Es besteht keine Pflicht, zuerst mit einer - echten - Vertrauensfrage, die auf Zustimmung zu Person und Programm des Bundeskanzlers zielt, im Bundestag die Kräfteverhältnisse auf die Probe zu stellen. Schließlich ist es auch nicht zweckwidrig, wenn der Kanzler im Hinblick auf seine künftige politische Rolle in seiner Fraktion und seiner Partei einen Zeitpunkt wählt, der ein Zerwürfnis noch nicht als irreparabel erscheinen lässt. Der Kanzler kann nicht, um die rechtliche Prüfung zu vereinfachen, gezwungen werden, die instabile Lage zu verschärfen, die er durch die auflösungsgerichtete Vertrauensfrage zu überwinden sucht.
- 144
c) Eine politische Lage, die eine auflösungsgerichtete Vertrauensfrage rechtfertigt, ist zweifelsfrei dann gegeben, wenn der Kanzler seine bisherige Mehrheit im Deutschen Bundestag durch Fraktionswechsel einzelner Abgeordneter verliert, wie dies beispielsweise im Jahr 1972 der Fall war. Bei der Bundestagsauflösung vom 22. September 1972 war durch eine Erosion der sozial-liberalen Koalitionsmehrheit im Bundestag eine politische Pattsituation zwischen Regierungsfraktionen und Opposition vorausgegangen, in der keine Seite mehr über die Kanzlermehrheit von damals 249 Stimmen verfügte (vgl. Blischke, Verfahrensfragen des Bundestages im Jahre 1972, in: Der Staat, Bd. 12, 1973, S. 65 ff.).
- 145
Die zweite Bundestagsauflösung vom 6. Januar 1983 stand im Zusammenhang mit einem konstruktiven Misstrauensvotum, dem in der Öffentlichkeit zwar nicht die Verfassungsmäßigkeit, wohl aber gerade auch im Blick auf die für den Koalitionswechsel verantwortliche Partei zwar nicht mehr die Legalität, wohl aber die Legitimität im Sinne einer Achtung des "demokratischen Anstands" abgesprochen worden war (vgl.BVerfGE 62, 1 <52, 57 f.>).
- 146
Diese Erfahrungen zeigen, dass seit Inkrafttreten des Grundgesetzes mit der auflösungsgerichteten Vertrauensfrage sehr sparsam und verantwortlich umgegangen worden ist.
- 147
4. Das Bundesverfassungsgericht prüft die zweckentsprechende Anwendung des Art. 68 GG nur in dem von der Verfassung vorgesehenen eingeschränkten Umfang. Zu dem vom Bundeskanzler behaupteten Verlust seiner parlamentarischen Mehrheit lassen sich mit den in einem verfassungsgerichtlichen Verfahren verfügbaren Erkenntnismitteln keine sicheren Feststellungen treffen, ohne die politische Handlungsfreiheit unangemessen zu beschränken (a). Das gewaltenteilende System des Grundgesetzes verteilt die Verantwortung für die Auflösung des Deutschen Bundestages auf drei Verfassungsorgane, deren Entscheidungen zudem der verfassungsgerichtlichen Kontrolle unterliegen (b). Von entscheidender Bedeutung ist im vorliegenden Verfahren, ob gemessen an den dargelegten Maßstäben (II. 1. bis 3.), die Handlungsfähigkeit der Regierung nicht mehr gesichert war oder ob der Kanzler - wie die Antragsteller vortragen - eine solche instabile Lage nur vorgeschoben hat, um in zweckwidriger Weise zu einer Neuwahl zu gelangen (c).
- 148
a) Die Beurteilung des zweckgemäßen Gebrauchs der auflösungsgerichteten Vertrauensfrage kann auf praktische Schwierigkeiten stoßen. Ob eine Regierung politisch noch handlungsfähig ist, hängt maßgeblich davon ab, welche Ziele sie verfolgt und mit welchen Widerständen sie aus dem parlamentarischen Raum zu rechnen hat. Derartige Einschätzungen haben Prognosecharakter und sind an höchstpersönliche Wahrnehmungen und abwägende Lagebeurteilungen gebunden.
- 149
Am sichersten ist der Fall zu beurteilen, wenn eine Mehrheit des Deutschen Bundestages sich offen und andauernd obstruktiv verhält und deutlich erklärt, zum Bundeskanzler kein Vertrauen mehr zu haben, aber sich ebenso erklärtermaßen nicht auf die Wahl eines neuen Kanzlers über den Weg des Art. 67 GG einigen kann. Im Fall einer solchen offenen Obstruktion bedarf es keiner Diskussion über die gerichtliche Kontrolldichte und den Einschätzungsspielraum des Bundeskanzlers, weil die Lage politischer Instabilität im Sinne einer Minderheitssituation der Regierung im Parlament klar zu erkennen ist.
- 150
Ebenso klar läge der Fall, wenn der Bundeskanzler seine Vertrauensfrage ersichtlich allein mit dem Ziel stellen würde, den Bundesrat mit einer Bestätigung der Bundesregierung durch Wahlakklamation politisch zu delegitimieren. In einer solchen Konstellation fehlte es bereits an der von Art. 68 GG vorausgesetzten Instabilität der Lage im Verhältnis zwischen Kanzler und Parlament (vgl.BVerfGE 62, 1 <46>).
- 151
Verfassungsrechtliche Schwierigkeiten bereitet dagegen der Fall, in dem der Bundeskanzler die Lage dahingehend einschätzt, dass eine stetige Unterstützung der Bundestagsmehrheit für seine Politik nicht mehr gewährleistet ist, bevor die Richtigkeit dieser Einschätzung in entsprechenden Abstimmungsniederlagen offenkundig geworden ist. Die Beurteilung dieser Fallkonstellation wird noch erschwert, wenn diese Behauptung mit der Prognose verbunden wird, die lähmenden Auswirkungen einer solchen Lage auf sein politisches Programm zeigten sich erst in der Zukunft.
- 152
Eine verdeckte Minderheitssituation des Bundeskanzlers tritt dann ein, wenn eine organisierte parlamentarische Mehrheit - die nominelle Kanzlermehrheit - sich zwar zu dem von ihr gewählten Kanzler erklärt und ihm äußerlich politische Unterstützung leistet, diese Unterstützung seines politischen Kurses aber in Wirklichkeit nicht so wirksam ist, dass der Bundeskanzler die von ihm konzeptionell vertretene Politik durchzusetzen vermag.
- 153
Eine Erosion und der nicht offen gezeigte Entzug des Vertrauens lassen sich ihrer Natur nach nicht ohne weiteres in einem Gerichtsverfahren darstellen und feststellen. Was im politischen Prozess in legitimer Weise nicht offen ausgetragen wird, muss unter den Bedingungen des politischen Wettbewerbs auch gegenüber anderen Verfassungsorganen nicht vollständig offenbart werden. Die Einschätzung des Bundeskanzlers, er sei für seine künftige Politik nicht mehr ausreichend handlungsfähig, ist eine Wertung, die durch das Bundesverfassungsgericht schon praktisch nicht eindeutig und nicht vollständig überprüft werden kann und ohne Beschädigung des politischen Handlungssystems auch nicht den üblichen prozessualen Erkenntnismitteln zugänglich ist. Selbst wenn man eine Beweisaufnahme für möglich oder geboten hielte, bliebe dem Kanzler ein eigener Einschätzungsspielraum in Bezug auf die festgestellten Tatsachen, insbesondere in Bezug auf deren Bedeutung für die künftige Entwicklung. Dem politischen Willensbildungsprozess mit seinen zulässigen, auch von taktischen und strategischen Motiven geprägten Verhaltensweisen und Rücksichtnahmen darf in Fragen der politischen Einschätzung nicht mit einer nach vollem Beweis strebenden gerichtlichen Sachverhaltsaufklärung Schaden zugefügt werden. Andernfalls wäre die vom Grundgesetz gewollte Balance zwischen effektiver rechtlicher Bindung der öffentlichen Gewalt und der Ermöglichung wirksamer politischer Handlungsfreiheit verletzt.
- 154
b) Das Grundgesetz hat, anders als die Weimarer Verfassung, die Entscheidung über die Auflösung des Bundestages nicht einem Verfassungsorgan allein in die Hand gegeben, sondern sie auf drei Verfassungsorgane verteilt und diesen dabei jeweils eigene Verantwortungsbereiche zugewiesen (vgl.BVerfGE 62, 1 <51> ). Die drei Verfassungsorgane - der Bundeskanzler, der Deutsche Bundestag und der Bundespräsident - haben es jeweils in der Hand, die Auflösung nach ihrer freien politischen Einschätzung zu verhindern. Dies trägt dazu bei, die Verlässlichkeit der Annahme zu sichern, die Bundesregierung habe ihre parlamentarische Handlungsfähigkeit verloren.
- 155
Die Verantwortungskette beginnt mit dem Bundeskanzler, weil ohne seinen Antrag kein Weg zur Auflösung des Deutschen Bundestages führt. Die Verfassung ordnet allein dem Bundeskanzler die Kompetenz zu, einen Antrag nach Art. 68 GG zu stellen. Mit dieser Regelung der Vertrauensfrage bringt das Grundgesetz die herausgehobene Stellung des Amtes des Bundeskanzlers im parlamentarischen Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck.
- 156
Der Deutsche Bundestag entscheidet in Kenntnis des Art. 68 GG, ob er mittels einer Verweigerung der Vertrauensbekundung den Weg zur Auflösung eröffnet. Es ist keine Lage denkbar, in der ein Bundeskanzler das Parlament gegen dessen Willen rechtlich zwingen könnte, an seiner eigenen Auflösung mitzuwirken. Auch bei knapper Mehrheit der Regierungskoalitionen könnte der Bundeskanzler allein mit der Opposition nicht die Auflösung herbeiführen. Der Bundeskanzler könnte noch nicht einmal in rechtlich verbindlicher Weise Minister, die zugleich Abgeordnete des Deutschen Bundestages sind, als Mitglieder der Regierung anweisen, in der gewünschten Weise abzustimmen; das freie Abgeordnetenmandat geht insoweit vor. Das Parlament kann nicht nur die Vertrauensfrage positiv beantworten, sondern es hat auch die Möglichkeit, einen neuen Bundeskanzler zu wählen. So ist im Jahr 1982 der Versuch des Bundeskanzlers Helmut Schmidt, auf dem Weg des Art. 68 GG zu Neuwahlen zu gelangen, durch die auf Grund von Art. 67 GG erfolgte Wahl von Helmut Kohl zum Kanzler unterbunden worden. Im vorliegenden Fall haben die Abgeordneten in Kenntnis der möglichen Konsequenzen mit großer Mehrheit dem Bundeskanzler die Bekundung des Vertrauens versagt und keinen neuen Kanzler gewählt. Die Mehrheit der Mitglieder des Bundestages wollte die Auflösung des Bundestages, wie dies auch von sämtlichen Fraktionen in der Aussprache am 1. Juli 2005 bekundet worden ist.
- 157
Als drittes Verfassungsorgan hat schließlich der Bundespräsident nach eigener politischer Beurteilung die Auflösung angeordnet. Dem vorgelagert hat der Bundespräsident bereits in eigener Verantwortung auch eine rechtliche Beurteilung der Voraussetzungen des Art. 68 GG vorgenommen. Auch wenn er sich dabei nur auf eine Evidenzkontrolle im Hinblick auf einen möglichen Missbrauch durch Bundeskanzler oder Bundestag beschränkt, so hat doch sein Wort als pouvoir neutre im Hinblick auf den Umfang der gerichtlichen Kontrolldichte Gewicht. Der Bundespräsident ist ein vom Grundgesetz in diesem Verfahren eigens vorgesehenes unabhängiges Verfassungsorgan, das zur Rechtsprüfung ebenso befugt wie sodann zu einer politischen Leitentscheidung im Hinblick auf die Anordnung oder Ablehnung der Auflösung berufen ist. Der Bundespräsident verfügt über eigene Möglichkeiten, auch die des persönlichen und vertraulichen Gesprächs, sich ein Bild davon zu machen, ob die Handlungsfähigkeit der Regierung in einer dem Zweck des Art. 68 GG entsprechenden Weise gefährdet oder bereits verloren gegangen ist.
- 158
Der für die Auflösung nach Art. 68 GG geltende anspruchsvolle Mechanismus der Gewaltenteilung vermag sich sinnvoll nur zu entfalten, wenn das Bundesverfassungsgericht die politische Einschätzung der Lage durch die zuvor tätigen Verfassungsorgane respektiert (vgl.BVerfGE 62, 1 <51>).
- 159
Dies heißt nicht, dass das Bundesverfassungsgericht zur verfassungsrechtlichen Prüfung im Organstreitverfahren nicht verpflichtet wäre; seine Prüfungskompetenz und Prüfungspflicht ist durch den zu respektierenden Einschätzungsspielraum eingeschränkt, aber nicht beseitigt (vgl.BVerfGE 62, 1 <51> ). Das Grundgesetz räumt dem Verfassungsrecht und der Verfassungsgerichtsbarkeit eine starke Stellung ein. Im internationalen Vergleich sind die Kompetenzen des Bundesverfassungsgerichts weit bemessen (vgl. Tomuschat, Das Bundesverfassungsgericht im Kreise anderer nationaler Verfassungsgerichte, in: Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. 1, 2001, S. 245 ff.). Dies ist ein Kennzeichen der deutschen freiheitlichen Nachkriegsordnung geworden. Gleichwohl hat das Grundgesetz nur die Kontrolle politischer Herrschaft gewollt und nicht die Verrechtlichung des politischen Prozesses. Dem Grundgesetz geht es um eine angemessene Teilung der Verantwortung. Jedes Verfassungsorgan übernimmt eine eigene Aufgabe, die Verfassung mit Leben zu erfüllen und fortzuentwickeln. Dem Bundesverfassungsgericht kommt dabei als dazu eigens eingerichtetem Verfassungsorgan zwar eine besondere Rolle zu, es kontrolliert als ein Gericht letztverbindlich. Es muss aber den anderen Verfassungsorganen den vom Grundgesetz garantierten Raum freier politischer Gestaltung und Verantwortung offen halten (vgl.BVerfGE 36, 1 <14 f.> ). Wegen des dreistufigen Entscheidungsprozesses sind die Überprüfungsmöglichkeiten des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen des Art. 68 GG weiter zurückgenommen als in den Bereichen von Rechtsetzung und Normvollzug. Das Grundgesetz vertraut insoweit in erster Linie auf das in Art. 68 GG angelegte System der gegenseitigen politischen Kontrolle und des politischen Ausgleichs zwischen den beteiligten obersten Verfassungsorganen. Allein dort, wo verfassungsrechtliche Maßstäbe für politisches Verhalten normiert sind, kann das Bundesverfassungsgericht ihrer Verletzung entgegentreten (BVerfGE 62, 1 <51>).
- 160
c) Auch wenn ein drohender Verlust politischer Handlungsfähigkeit am sachnächsten vom Bundeskanzler selbst beurteilt werden kann, hat das Bundesverfassungsgericht doch zu prüfen, ob die Grenzen seines Einschätzungsspielraums eingehalten sind, um die Bindung aller staatlichen Organe an das Grundgesetz sicherzustellen. Fehlt es, gemessen an der zu Tage liegenden politischen Gesamtlage, an Anhaltspunkten dafür, dass der Bundeskanzler für sein Regierungshandeln und seine politische Konzeption die parlamentarische Mehrheitsunterstützung verloren hat oder zu verlieren droht, kann er sich nicht erfolgreich auf seine Einschätzungsprärogative berufen. Seine Entscheidung muss auf Tatsachen gestützt sein. Die allgemeine politische Lage sowie einzelne Umstände müssen dabei allerdings nicht zwingend zur Einschätzung des Kanzlers führen, sondern sie lediglich plausibel erscheinen lassen. Der Einschätzungsspielraum des Kanzlers wird nur dann in verfassungsrechtlich gefordertem Umfang geachtet, wenn bei der Rechtsprüfung gefragt wird, ob eine andere Einschätzung der politischen Lage auf Grund von Tatsachen eindeutig vorzuziehen ist (vgl.BVerfGE 62, 1 <52> ). Tatsachen, die auch andere Einschätzungen als die des Kanzlers zu stützen vermögen, sind nur dann geeignet, die Einschätzung des Bundeskanzlers zu widerlegen, wenn sie keinen anderen Schluss zulassen als den, dass die Einschätzung des Verlusts politischer Handlungsfähigkeit im Parlament falsch ist.
- 161
Das Bundesverfassungsgericht darf sich freilich gegenüber solchen Umständen gerade auch angesichts des weiten Einschätzungsspielraums des Kanzlers nicht verschließen. Es darf jedenfalls Tatsachen, die der Beurteilung des Kanzlers widersprechen, nicht unberücksichtigt lassen, auch dann, wenn sie erst während des gerichtlichen Verfahrens eintreten und geeignet sind, die Plausibilität der Lagebeurteilung des Bundeskanzlers in Frage zu stellen.
- 162
Bei der Würdigung der Tatsachen ist zu berücksichtigen, dass Entwicklungen im parlamentarischen Raum nach der Ankündigung des Bundeskanzlers, die Vertrauensfrage zu stellen, möglicherweise nicht geeignet sind, die im Zeitpunkt dieser Ankündigung gegebene Plausibilität seiner Einschätzung zu erschüttern. Diese Entwicklungen können ihrerseits von der bloßen Ankündigung der Vertrauensfrage und der davon ausgehenden Disziplinierungswirkung auf die Abgeordneten beeinflusst sein. Dies kann insbesondere in Fällen, in denen - wie vorliegend - der Bundeskanzler sich auf das Bestehen einer latenten Minderheitslage beruft, von Bedeutung sein und vom Bundeskanzler in seine Bewertung im Zeitpunkt des Antrags nach Art. 68 GG einbezogen werden. Die Ankündigung des Kanzlers, über eine Vertrauensfrage zur Neuwahl gelangen zu wollen, kann diejenige politische Lage gravierend verändern, die der Rechtfertigung zu einem solchen Vorgehen zu Grunde liegt. Der dann vorwirkende Wahlkampf zwingt dazu, die politischen Reihen zu schließen, formiert die Parteien für den Wettstreit untereinander und lässt die Handlungsfreiheit für abweichendes Verhalten innerhalb der Partei schrumpfen.
- 163
III.
Die angegriffenen Entscheidungen des Bundespräsidenten sind mit dem Grundgesetz vereinbar.
- 164
Die von Art. 68 GG geforderten Verfahrensschritte sind eingehalten. Ein zweckwidriger Gebrauch der Vertrauensfrage, um zur Auflösung des Deutschen Bundestages und zu einer vorgezogenen Neuwahl zu gelangen, lässt sich nicht feststellen. Der Einschätzung des Bundeskanzlers, er könne bei den bestehenden Kräfteverhältnissen im Deutschen Bundestag künftig keine vom Vertrauen der Parlamentsmehrheit getragene Politik mehr verfolgen, ist keine andere Einschätzung eindeutig vorzuziehen (1.). Die Anordnungen des Bundespräsidenten lassen keine Ermessensfehler erkennen (2.).
- 165
1. Der Bundeskanzler hat Tatsachen benannt, die für seine Einschätzung der politischen Kräfteverhältnisse im Deutschen Bundestag sprechen (a). Diese Einschätzung entspricht auch der vom Bundeskanzler dargelegten politischen Gesamtlage (b). Es sind keine Tatsachen vorgetragen oder erkennbar, die die Einschätzung des Bundeskanzlers unzweifelhaft widerlegen (c).
- 166
a) Der Kanzler hat in der Sitzung des Deutschen Bundestages vom 1. Juli 2005 zur Begründung seiner Vertrauensfrage unter anderem angeführt, sein Reformprogramm der "Agenda 2010" habe zu Streit nicht nur zwischen den Parteien, sondern auch in seiner Partei, der SPD, geführt. Der Kanzler sprach dabei von "heftigen Debatten", die dadurch verstärkt worden seien, dass die SPD seit dem Beschluss der "Agenda 2010" bei sämtlichen Landtagswahlen und der Europawahl Stimmen verloren habe. Er hat dazu ausgeführt: "Es ging und es geht um die Frage, ob die Reformen der Agenda 2010 überhaupt notwendig sind oder ob sie nicht gar zurückgenommen werden sollten. Diese Debatte hat so weit geführt, dass SPD-Mitglieder damit drohten, sich einer rückwärts gewandten, linkspopulistischen Partei anzuschließen, die vor Fremdenfeindlichkeit nicht zurückschreckt" (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 185. Sitzung vom 1. Juli 2005, Plenarprotokoll 15/185, S. 17467). Der Kanzler verwies auf Signale einer gewollten Umkehr aus seiner Partei, die "in den Wochen vor dem 22. Mai" fast täglich Gegenstand der Medienberichterstattung waren, "auch aus dem parlamentarischen Raum heraus" (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 185. Sitzung vom 1. Juli 2005, Plenarprotokoll 15/185, S. 17467).
- 167
Der Bundeskanzler hat ausgeführt, er befürchte daher, dass künftig in zentralen Feldern seiner Regierungspolitik, vor allem von der "Agenda 2010", abweichende Stimmen die Mehrheit gefährden würden. Er hat auch erklärt, weshalb öffentliche Loyalitätsbekundungen, zu denen sich nach seiner Ankündigung, auf Neuwahlen hinwirken zu wollen, eine Reihe von Abgeordneten veranlasst sah, an dieser Einschätzung nichts geändert haben:
- 168
"Ebenso klar muss auch sein, dass dort, wo Vertrauen nicht mehr vorhanden ist, öffentlich nicht so getan werden darf, als gäbe es dieses Vertrauen. Ich habe auch das erleben müssen. Auch das ist Bestandteil meiner politischen Bewertung. Und diese ist eindeutig: Eine Bewertung der politischen Kräfteverhältnisse vor und nach der Entscheidung, Neuwahlen anzustreben, muss dazu führen - dessen bin ich mir ganz sicher -, dass ich unter den aktuellen Bedingungen nicht auf das notwendige, auf stetiges Vertrauen im Sinne des Art. 68 Grundgesetz rechnen kann" (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 185. Sitzung vom 1. Juli 2005, Plenarprotokoll 15/185, S. 17467). Damit hat der Kanzler sowohl Tatsachen genannt als auch eine Einordnung in einen politischen Kontext vorgenommen, auf die er seine Bewertung und seine Schlussfolgerung stützt. Er hat dabei hinreichend deutlich ausgedrückt, dass er aus partei- und fraktionspolitischer Rücksichtnahme nicht Ross und Reiter nennt. Zusätzlich hat er mit dem Gewicht seiner persönlichen Vertrauenswürdigkeit von Erfahrungen berichtet, die er auch mit der Unaufrichtigkeit Einzelner aus den eigenen politischen Reihen, deren Namen er im Dunkeln lässt, gemacht hat.
- 169
Der hergestellte politische Zusammenhang mit der anhaltenden Kritik an seiner Politik der "Agenda 2010" und den seit 2003 für die SPD ganz überwiegend verlorenen Landtagswahlen bezieht sich auf allgemein zugängliche Tatsachen. Sie stützen den vom Kanzler gezogenen Schluss, dass nach dem Regierungswechsel in Schleswig-Holstein hin zu einer großen Koalition und der sich anbahnenden Gründung einer neuen mit der SPD konkurrierenden Partei unter Beteiligung des ehemaligen Parteivorsitzenden der SPD der Kanzler mit einer Niederlage der SPD spätestens bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zu einem substanziellen politischen Kurswechsel auch aus der SPD-Bundestagsfraktion heraus genötigt worden wäre, wenn er auf die Ankündigung der vorgezogenen Neuwahl verzichtet hätte.
- 170
Diese Sicht des Bundeskanzlers wird vom Partei- und Fraktionsvorsitzenden der SPD ausdrücklich geteilt. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, der Parteivorsitzende Franz Müntefering, hat am 1. Juli 2005 im Parlament erklärt: "In einer Situation wie dieser, mit einer Mehrheit von drei Stimmen aufseiten der Koalition im Bundestag und einer aufziehenden PDS/ML, unbeirrt durchs Feuer der Reformen zu gehen, ist nicht einfach, nicht für die Partei, nicht für die Abgeordneten. Dass in dieser Lage manche von uns dem Bundeskanzler und unserer Politik handfeste Kursänderungen abverlangten, konnte jeder lesen und hören. Ich fand das falsch, aber es war so" (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 185. Sitzung vom 1. Juli 2005, Plenarprotokoll 15/185, S. 17473). Im politischen Raum unwidersprochen geblieben ist die zusätzliche Mitteilung Franz Münteferings, er habe dem Bundeskanzler "gesagt", dass er vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Sorge gehabt habe "um die Handlungsfähigkeit" seiner Partei und Fraktion und damit letztlich der Bundesregierung (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 185. Sitzung vom 1. Juli 2005, Plenarprotokoll 15/185, S. 17474). Diese Ausführungen sind nicht nur eine Bestätigung der Wertung des Bundeskanzlers, sie enthalten auch die Wiedergabe einer zusätzlichen Tatsache. Danach hat derjenige, der bei der Gewährleistung der stetigen parlamentarischen Unterstützung der Regierungspolitik am engsten mit dem Kanzler zusammenarbeitet, ihm vor der Landtagswahl vom 22. Mai 2005 von seinen Sorgen um die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung berichtet.
- 171
Die Antragsteller haben das Faktum eines solchen Gesprächs zwischen dem Kanzler und dem Partei- und Fraktionsvorsitzenden mit diesem Inhalt nicht in Abrede gestellt. Sie bestreiten nur, dass die Sorge des Fraktionsvorsitzenden in der Sache berechtigt gewesen sei. Der Kanzler allerdings durfte seiner Einschätzung zu Grunde legen, dass der maßgeblich seine Politik unterstützende SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende ihm im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen für eine Unterstützung der Politik des Kanzlers durch die Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag keine Gewähr mehr geben konnte.
- 172
b) Auch die politische Gesamtlage steht der Plausibilität der Einschätzung des Bundeskanzlers nicht entgegen. Die Annahme fehlender politischer Handlungsfähigkeit im Parlament fügt sich widerspruchsfrei in eine politische Ereignislinie ein, die seit der Ankündigung der "Agenda 2010" die Wahlperiode des 15. Deutschen Bundestages begleitet hat. Die Kritik war zuvor so weit gegangen, dass Vertreter der Partei-Linken den Rücktritt von Gerhard Schröder als SPD-Parteivorsitzender verlangt hatten.
- 173
Es gibt veröffentlichte Hinweise, dass bereits der überraschende Rücktritt des Bundeskanzlers vom Amt des Bundesvorsitzenden der SPD und die Wahl des neuen Vorsitzenden Müntefering Anfang 2004 auf Druck der parteiinternen Kritiker am Kurs der Bundesregierung und vor allem verbunden mit der Kritik an der Reform des Arbeitsmarktes stattfanden. Jedenfalls kommentierte ein größerer Teil der Presse den angekündigten Wechsel im Parteivorsitz ähnlich wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. Februar 2004: "Welcher Kanzler stellt sich schon freiwillig unter Kuratel? Dass der Sozialdemokrat Schröder - statt sein eigener Herr zu sein wie bisher - sich nun den Fraktionsvorsitzenden Müntefering auch noch als seinen Parteivorsitzenden gewünscht habe, klingt gut, taugt aber nicht für die Geschichtsbücher. Die Parteilinke, von Jüttner über Lafontaine bis Ypsilanti, hat dem Kanzler den Parteivorsitz entwunden, und Schröder kann noch von Glück sagen, dass Müntefering für beide Seiten akzeptabel ist." Derlei Kommentare müssen sachlich nicht zutreffend sein. Sie zeichnen aber doch ein Bild der politischen Gesamtlage in der Bundesrepublik Deutschland, die jedenfalls der Einschätzung des Bundeskanzlers von der schleichenden Erosion seiner Vertrauensgrundlagen im Parlament nicht widerspricht. Es entspricht auch allgemeiner Erfahrung, dass mit jeder für eine Regierungspartei verlorenen Landtagswahl sich für den Bundeskanzler verstärkter politischer Druck aufbaut, von dem eingeschlagenen politischen Weg abzuweichen, wenn dieser Weg als unpopulär gilt.
- 174
c) Weder vor noch nach der Ankündigung vom 22. Mai 2005, Neuwahlen anzustreben, sind Tatsachen offenbar geworden, die die Einschätzung des Bundeskanzlers widerlegen und deshalb eine andere Einschätzung als die des Kanzlers als eindeutig vorzugswürdig erscheinen lassen.
- 175
aa) Als eindeutige Widerlegung der Einschätzung des Bundeskanzlers wird sein schon am 22. Mai 2005 und seitdem mehrfach vorgetragenes Argument angeführt, er wolle sich ein neues Mandat für seine Politik vom Wähler verschaffen.
- 176
Der Begründung, das Volk über die Politik des Kanzlers entscheiden zu lassen, fehlt bereits durch ihre rhetorische Qualität und ihre Mehrdeutigkeit die Eignung, als entgegenstehende Tatsache die Einschätzung des Kanzlers eindeutig zu widerlegen. Eine solche Formulierung kann als rhetorische Floskel gemeint sein, die eine Referenz an das Demokratieprinzip zum Ausdruck bringt.
- 177
Es lässt sich auch nicht feststellen, dass der Kanzler ein dem Zweck des Art. 68 GG widersprechendes Plebiszit anstrebt. Wer sich der Bundestagswahl stellt, kann die Themen vorweg nicht mit Sicherheit bestimmen. Es wird in dem Zeitraum seit dem 1. Juli 2005 bis zur Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht auch über keine einzelne Sachfrage so herausgehoben diskutiert, dass von einem plebiszitär verformten Wahlkampf gesprochen werden kann. Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob die Entscheidung des Bundeskanzlers von weiteren Motiven begleitet wurde (BVerfGE 62, 1 <62>).
- 178
bb) Die Einschätzung des Kanzlers wird ferner nicht dadurch unglaubwürdig oder widerlegt, dass er ergänzend auf die politischen Verhältnisse des Bundesrates abstellt. Denn damit macht er nur kenntlich, dass seine politische Bewegungsfreiheit für die von ihm für richtig gehaltene Politik gegenüber seiner Fraktion durch einen von der Opposition beeinflussten Bundesrat zusätzlich geschmälert wird. Kompromisse, die er im Vermittlungsausschuss eingehen muss, um die Zustimmung des Bundesrates zu gewinnen, und die er ohne Verletzung seines Konzepts auch noch eingehen kann, vermindern möglicherweise in der Folge die Aussichten, seine politische Linie in den Regierungsfraktionen durchzusetzen. So wird in einem Schreiben des Bundeskanzleramtes an das Bundespräsidialamt vom 12. Juli 2005 darauf hingewiesen, dass es angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat erschwert werde, die Geschlossenheit der Koalitionsmehrheit im Bundestag herzustellen und damit politische Vorhaben in einer ohnehin knappen Parlamentsmehrheit durchzusetzen (vgl. Schreiben des Bundeskanzleramtes an das Bundespräsidialamt vom 12. Juli 2005, S. 12 f.).
- 179
cc) Die Einschätzung des Bundeskanzlers, es habe ihm der Verlust der politischen Handlungsfähigkeit gedroht, wird nicht dadurch widerlegt, dass der Fraktionsvorsitzende Müntefering bei der Aussprache zur Vertrauensfrage des Bundeskanzlers am 1. Juli 2005 davon gesprochen hat, dass der Kanzler das Vertrauen der SPD-Fraktion besitze (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 185. Sitzung vom 1. Juli 2005, Plenarprotokoll 15/185, S. 17474 f.). Diese Äußerung fiel im Zusammenhang mit der Feststellung, dass die Fraktion den Bundeskanzler weiter als Bundeskanzler haben wolle; sie bezog sich ersichtlich allein auf die insoweit unumstrittene Person des Kanzlers und hatte nicht den Sinn, vorausgegangene, die Einschätzung des Bundeskanzlers bestätigende Äußerungen zurückzunehmen. Dass vorhandene Unterstützung für eine erneute Kandidatur des amtierenden Bundeskanzlers das Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 68 GG nicht ausschließt, hat das Bundesverfassungsgericht bereits im Zusammenhang mit der 1982 von Bundeskanzler Kohl gestellten Vertrauensfrage entschieden (vgl.BVerfGE 62, 1 <38> ). Auch mit der Äußerung des Fraktionsvorsitzenden Müntefering, dass es hier nicht um Misstrauen gehe (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 185. Sitzung vom 1. Juli 2005, Plenarprotokoll 15/185, S. 17474 f.), wurden nicht die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 68 GG verneint. Gemeint war dem Zusammenhang nach eindeutig, dass man sich nicht in der Situation eines konstruktiven Misstrauensvotums befinde; dies bekräftigte der Redner im unmittelbaren Anschluss, indem er der Oppositionsführerin prophezeite, sie werde, wenn sie einen entsprechenden Antrag stelle, sehen, dass sie im Bundestag in der Minderheit sei.
- 180
dd) Dass der Bundeskanzler mit Blick auf einen möglichen Wahlkampf teilweise politische Forderungen derjenigen Abgeordneten übernimmt, an deren parlamentarischer Unterstützung er zuvor Zweifel geäußert hat, ist gleichfalls nicht geeignet, eine Widerlegung der Einschätzung zu tragen. In diesem Zusammenhang wird als zweifelsfreie Widerlegung der Einschätzung des Kanzlers der Umstand angeführt, dass zwischen dem 22. Mai und dem 1. Juli 2005 die angeblich instabile Koalitionsmehrheit eine Vielzahl von zum Teil umstrittenen Gesetzen mit Mehrheit verabschiedet und dadurch ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt habe.
- 181
Die dementsprechende Einschätzung des Kanzlers würde etwa dann widerlegt, wenn entweder die Kanzlermehrheit gerade für solche innerhalb der Partei und der Fraktion umstrittenen Gesetzesvorhaben mobilisiert worden wäre, die unzweideutig als konzeptionell tragend und im Meinungsstreit entscheidend - im vorliegenden Fall vor allem in der Reform der Arbeitsmarktpolitik - betrachtet werden müssen. Die Einschätzung des Kanzlers könnte zudem widerlegt sein, wenn er selbst die Initiative für Gesetze ergriffen hätte, die seiner bisherigen Politik ersichtlich zuwiderliefen.
- 182
In der Sitzung des Deutschen Bundestages am Vortag der Vertrauensfrage stand jedoch kein Gesetzesvorhaben auf der Tagesordnung, das als Abkehr von der politischen Konzeption des Kanzlers zu betrachten wäre und damit seiner Argumentation die Plausibilität nähme. Umgekehrt handelte es sich auch nicht um Gesetze, die von seinen innerparteilichen Kritikern als Zumutung hätten empfunden werden können. So nahmen die Koalitionsfraktionen mit eigener Mehrheit Gesetze zur Umweltstatistik, zum Düngemittelrecht und Saatgutverkehr, zur Beschleunigung der Umsetzung von öffentlich-privaten Partnerschaften, zum Abgeordnetenrecht, zum Protokoll von Kyoto und zur Bundesanstalt für den Digitalfunk an (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 184. Sitzung vom 30. Juni 2005, Plenarprotokoll 15/184, S. 17305 ff.). Die bereits zuvor im Bundestag beschlossene Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld für ältere Arbeitslose ist zwar eine Korrektur an der ursprünglichen Arbeitsmarktreform (vgl. Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BTDrucks 15/5556). Es handelt sich aber dabei nicht um einen gravierenden Einschnitt in die Reformkonzeption und erst recht nicht um eine grundsätzliche Abkehr von der damit verbundenen politischen Zielsetzung.
- 183
ee) Die Annahme der Antragstellerin zu I., die Änderung der Tagesordnung des Deutschen Bundestages vom 30. Juni 2005 stehe im Zusammenhang mit der Vertrauensfrage, ist ebenfalls nicht eindeutig. Nach Ansicht der Antragstellerin zu I. hat die Absetzung der geplanten Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes von der Tagesordnung (vgl. Deutscher Bundestag, Stenografischer Bericht der 184. Sitzung vom 30. Juni 2005, Plenarprotokoll 15/184, S. 17305), die die zweite und dritte Lesung vorsah, das Ziel verfolgt, die Handlungsfähigkeit der Regierungskoalitionen gerade auch in politisch schwierigen Materien nicht auch noch damit unter Beweis zu stellen, dass dieses Gesetz mit Kanzlermehrheit verabschiedet wird. Die Mehrdeutigkeit ergibt sich schon daraus, dass die geplanten Gesetzesänderungen keinen Bezug zu umstrittenen Grundsatzfragen der Arbeitsmarktreformpolitik aufwiesen und deshalb weder für die fraktionsinternen Kritiker der Politik des Bundeskanzlers noch wiederum für den Kanzler und seine Reformpolitik ein gravierendes politisches Zugeständnis verlangten. Insofern war die Änderung des Entsendegesetzes kein Test für die Verlässlichkeit der Koalitionsmehrheit. Die Absetzung des Gesetzentwurfs könnte im Übrigen auch ganz andere Gründe gehabt haben, wie zum Beispiel die Absicht, im Wahlkampf nutzbaren Einwänden der Opposition (<http://www.bundestag.de>, hib-Meldung vom 29. Juni 2005) die Grundlage zu entziehen.
- 184
2. Anhaltspunkte dafür, dass der Bundespräsident mit der Anordnung, den 15. Deutschen Bundestag aufzulösen, die ihm von der Verfassung gezogenen Grenzen überschritten hätte, liegen nicht vor.
- 185
Der Bundespräsident hat den ihm vom Bundeskanzler unterbreiteten Vorschlag, den Deutschen Bundestag aufzulösen, überprüft. Es kann nicht festgestellt werden, dass dem Bundespräsidenten bei der Ausübung des ihm eingeräumten weiten politischen Ermessens ein Verstoß gegen das Grundgesetz unterlaufen wäre. Der Bundespräsident hat die ihm eröffnete politische Entscheidungsfreiheit gesehen und genutzt. Er hat Ermessenserwägungen angestellt und ist in seiner Gesamtabwägung zu dem verfassungsrechtlich unbedenklichen Ergebnis gekommen, dass dem Wohl des Volkes mit einer Neuwahl am besten gedient sei.
- 186
weiter: BundesVerfassungsGerichtUndNeuwahl/DieEntscheidungImDetail