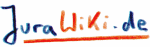zurück: ../AbweichendeMeinungJentsch
zum Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005 - 2 BvE 4/05 - - 2 BvE 7/05 -
1. Die Vertrauensfrage ist, wie die Frage vor dem Traualtar, keine Wissensfrage, auf die ebensogut wie der Gefragte oder besser ein Anderer antworten könnte. Der Bundeskanzler, der die Vertrauensfrage stellt, fragt nicht nach einem Wissen, sondern nach dem Willen des Parlaments und der Abgeordneten, an die die Frage nach Art. 68 GG zu richten ist: nach ihrem Willen, ihn und sein politisches Programm mit ihrem künftigen Abstimmungsverhalten zu unterstützen. Die Vertrauensfrage kann daher nur vom Parlament selbst beantwortet werden.
- 213
Die Auslegung des Art. 68 GG, die das Bundesverfassungsgericht 1983 entwickelt und heute in wesentlichen Hinsichten bekräftigt hat, läuft stattdessen darauf hinaus, dass die Beantwortung dieser Frage zur Überprüfung durch den Bundespräsidenten und das Bundesverfassungsgericht gestellt und damit ihres adressatenabhängigen Sinns beraubt wird. Der Deutsche Bundestag, an den nach Art. 68 GG die Vertrauensfrage zu richten ist, bleibt nach dieser Auslegung nur scheinbar ihr wirklicher Adressat. Die Abgeordneten dürfen zwar antworten, aber ihre Antwort muss, ja darf nach dieser Auslegung nicht für bare Münze genommen werden. Wenn der Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die in Art. 68 Abs. 1 Satz 1 GG vorgesehene Mehrheit gefunden hat, der Antrag also vom Bundestag abgelehnt worden ist, soll der Bundespräsident, und nach ihm im Streitfall das Bundesverfassungsgericht, berechtigt und verpflichtet sein zu prüfen, ob eine dem Zweck des Art. 68 GG entnommene - ursprünglich als "ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal" bezeichnete (vgl. BVerfGE 62, 1 <37>) - Voraussetzung des Art. 68 GG vorliegt, wonach der Bundestag nur aufgelöst werden darf, wenn der Bundeskanzler wirklich der Unterstützung durch die Mehrheit des Bundestages nicht sicher sein kann und daher in seiner Handlungsfähigkeit tatsächlich beeinträchtigt ist. Der Antwort des Parlaments sollen Bundespräsident und Bundesverfassungsgericht also zu misstrauen und gegebenenfalls festzustellen haben, dass das vom Parlament bekundete Vertrauensdefizit in Wahrheit gar nicht besteht.
- 214
2. Sowohl das Urteil von 1983 als auch die heutige Entscheidung verdunkeln diese Bedeutung der gewählten Auslegung, indem sie als Objekt des Misstrauens nicht den Bundestag und dessen Antwort, sondern den Bundeskanzler und dessen Frage in den Vordergrund rücken. Schon der Bundeskanzler, so heißt es in der Entscheidung von 1983, dürfe die Vertrauensfrage nur stellen, wenn die Kräfteverhältnisse im Bundestag eine vom stetigen Vertrauen der Mehrheit getragene Politik nicht mehr ermöglichen (BVerfGE 62, 1 <49 f.>). Die jetzige Entscheidung folgt diesem Ansatz. Sie geht davon aus, dass bereits die Vertrauensfrage, jedenfalls wenn sie auf Auflösung gerichtet ist, "ausnahmsweise nur dann gerechtfertigt" sei, wenn die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung verloren gegangen ist, was bei "zweifelhafter" oder nicht mehr "verlässlicher" parlamentarischer Unterstützung der Fall sein soll. Den Worten nach konzentriert sich damit die Prüfung, ob verfassungsmäßig vorgegangen wurde, auf die Frage des Kanzlers. Tatsächlich betrifft der Vorwurf, eine "instabile Lage" fehlenden Vertrauens in verfassungswidriger Weise nur vorgespielt zu haben, aber zwangsläufig auch das Parlament; mit der Prüfung, ob dies der Fall ist, wird auch die Entscheidung des Parlaments hinterfragt.
- 215
Die Antragsteller umschiffen diese Einsicht mit der Annahme, der Verfassungsverstoß, der in einer vom Bundeskanzler unangebracht gestellten Vertrauensfrage liege, wirke ohne weiteres auf die nachfolgenden Schritte des Verfahrens nach Art. 68 GG fort (s. auch bereitsBVerfGE 62, 1 <36> ). Mit anderen Worten: der Kanzler bestimmt; von seiner Frage hängt alles ab. Der Bundestag erscheint so als ein willenloses Anhängsel, Instrument und Opfer des Bundeskanzlers, zwangsläufig infiziert von dessen Fehlern und unfähig, die Verfassung einzuhalten, wo dieser sie missachtet. Dass diese Präsentation der verfassungsrechtlich vorgesehenen Rolle des Bundestages nicht gerecht wird, muss nicht näher begründet werden. Wenn es im Vertrauensfragedrama einen Sündenfall gibt, dann ist der Bundestag derjenige, der in den Apfel gebissen hat. Der Senat stellt das der Sache nach nicht in Abrede. Er weist auf die rechtliche Entscheidungsfreiheit des Bundestages bei der Beantwortung der Vertrauensfrage hin, zieht daraus aber nicht die notwendige Konsequenz:
- 216
Die Auslegung des Art. 68 GG, die den Bundespräsidenten und das Bundesverfassungsgericht in die Lage bringt, eine Vertrauensfrage des Bundeskanzlers auf ihre situative Berechtigung überprüfen und unter Umständen als verfassungswidrig beurteilen zu müssen, ist gleichbedeutend mit der Ermächtigung und Verpflichtung, unter denselben Umständen auch die Antwort des Bundestages und damit die Mandatsausübung von Abgeordneten als falsch zu qualifizieren, denn die eine Beurteilung schließt die andere ein. Wenn der Bundeskanzler die Vertrauensfrage zu Unrecht, nämlich in einer Lage tatsächlich vorhandenen Vertrauens, gestellt haben soll, kann der Bundestag sie nicht zu Recht verneint haben. Die Rolle, die das Bundesverfassungsgericht mit dieser Auslegung dem Bundespräsidenten und sich selbst zuweist, ist fehlbesetzt. Dass die vorgesehenen Akteure sie nicht ausfüllen können und dürfen, liegt in der Natur der Vertrauensfrage als einer nicht auf wirklichkeitsbeschreibende Wissenserklärung, sondern auf wirklichkeitsformende (performative) Willensbekundung gerichteten Frage und in der Natur des freien Mandats der Bundestagsabgeordneten (Art. 38 Abs. 1 GG). Performative Äußerungen können prinzipiell nicht sinnvoll durch deskriptive korrigiert werden.
- 217
Die Sinnwidrigkeit solchen Unterfangens zeigt sich auch anhand einer Eigenheit der Vertrauensfrage, die mit ihrer performativen Zielrichtung zusammenhängt. Als Frage, die auf parlamentarische Willensbekundung und den damit verbundenen politischen Selbstbindungseffekt zielt, ist die Vertrauensfrage zweckmäßigerweise unbestimmt. Die Abgeordneten sollen - und können im Hinblick auf Art. 38 Abs. 1 GG – keine rechtsverbindlichen Versprechungen in Bezug auf ihr Abstimmungsverhalten zu konkreten künftigen politischen Projekten des Kanzlers abgeben. Auch ein Versuch des Bundeskanzlers, ihnen wenigstens rechtlich unverbindliche, aber konkrete, detailliert-projektbezogene Zusicherungen für künftige Abstimmungen abzulocken, ist weder in Art. 68 GG noch in Art. 81 Abs. 1 Satz 2 GG vorgesehen. Das konsensstiftende Potential der Vertrauensfrage liegt darin, dass die unter dem Druck drohender Auflösung des Bundestages mit einer inhaltlich weitgehend unbestimmten Vertrauensbekundung eingegangene begrenzte politische Selbstbindung des Parlaments dem Überspringen von Konflikten dienen kann, die in den Einzelheiten des künftig zu Beschließenden angelegt sind. Die Vertrauensfrage wirkt also, wenn sie über die jeweilige Einzelabstimmung hinaus stabilisierend wirkt, gerade auch durch ihre Unbestimmtheit. Jede externe Prüfung der Frage, ob der Bundeskanzler für seine Politik auf die Gefolgschaft des Parlaments rechnen kann, würde dagegen voraussetzen, dass zunächst bestimmt wird, um welche Politik es überhaupt geht. Zum Zweck der Prüfung, die der Senat dem Bundespräsidenten und sich selbst abverlangt, müsste daher, wenn sie ernst genommen würde, der Bundeskanzler zur Präzisierung des politischen Programms angehalten werden, für das er keine hinreichende parlamentarische Unterstützung erwarten zu können behauptet, bevor der Versuch gemacht wird, zu klären, ob seine Behauptung richtig ist. Das Präzisierungsverlangen griffe in die Kompetenz des Kanzlers zur Gestaltung seiner Politik ein, denn die Entscheidung darüber, welche Politik zu welchem Zeitpunkt verfolgt, offenbart und präzisiert wird, ist selbst wesentliches Politikelement. Wohin im Übrigen der Versuch einer Verifikation oder Falsifikation der vom Bundeskanzler behaupteten negativen Unterstützungserwartung führt, wird im vorliegenden Verfahren deutlich: Er führt dazu, dass über Fragen, die den Willen des Parlaments betreffen, nicht durch parlamentarische Abstimmung befunden wird, sondern außerhalb des Parlaments anhand von widersprechenden Äußerungen und Einschätzungen unterschiedlicher Akteure, Erklärungen des Bundeskanzlers, Erklärungen einzelner Abgeordneter, in Presseartikeln "veröffentlichten Hinweisen", Mutmaßungen über den Zugeständnis- oder Zumutungscharakter getroffener politischer Entscheidungen und Spekulationen über die möglichen Wirkungen vergangener Ereignisse auf das künftige Verhalten der Abgeordneten.
- 218
Ein juristisches Prüfprogramm, das den angeblich prüfungspflichtigen Organen aufgibt, in dieser Weise im Gewand verfassungsrechtlicher Prüfung die wahre Politik anderer Verfassungsorgane zu bestimmen, ist von einem großen Teil der Literatur, die sich mit der Auslegung des Art. 68 GG überhaupt näher auseinandergesetzt hat, schon im Zusammenhang mit der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers Kohl und der dazu ergangenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts als unangemessen zurückgewiesen worden (aus der damaligen Diskussion siehe besonders Seuffert, AöR 108 <1983>, S. 403 ff., Geiger, JöR 33 <1984>, S. 41 ff., und Ladeur, RuP 1984, S. 68 ff.; vgl. auch Hermes, in: Dreier, GG, Bd. 2, 1998, Art. 68 Rn. 15; Badura, ThürVBl 1994, S. 169 <174>; Püttner, NJW 1983, S. 15 <16>; Grote, DuR 1983, S. 26 <29>; Liesegang, NJW 1983, S. 147 <149>).
- 219
3. Der Unangemessenheit des aufgestellten Prüfprogramms ist nicht dadurch zu entkommen, dass dem Bundeskanzler für die Stellung der Vertrauensfrage ein Einschätzungsspielraum zugebilligt wird, der erst dann überschritten sein soll, wenn eine abweichende Beurteilung eindeutig vorzuziehen ist. Wenn dieser Einschätzungsspielraum von der zugeschriebenen Kontrollfunktion etwas übriglässt, beseitigt er das Problem nicht, das er lösen soll. Lässt er nichts davon übrig, dann bleibt auch von dem ungeschriebenen Tatbestandsmerkmal, auf das der Einschätzungsspielraum sich bezieht, nichts mehr übrig, was einleuchtend machen könnte, dass es überhaupt aufgestellt wird. Es fungiert dann der Sache nach nicht mehr als ein Entscheidungskriterium, das den Namen "Tatbestandsmerkmal" verdiente, sondern nur noch als Ansatzpunkt für eine Kontrollinszenierung, in der das Bundesverfassungsgericht sich selbst eine bloß scheinbar belangvolle Rolle zugeschrieben hat.
- 220
So liegen die Dinge. Die Befugnis und Pflicht zur Feststellung des wirklichen Parlamentswillens, die das Gericht mit der Aufstellung eines ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals des Art. 68 Abs. 1 Satz 1 GG dem Bundespräsidenten und sich selbst zugeschrieben hat, wird mit dem eingeräumten Einschätzungsspielraum eingeschränkt auf Fälle, in denen der Bundeskanzler eindeutig zu Unrecht von nicht hinreichend verlässlicher Unterstützungsbereitschaft des Parlaments ausgeht. Die Bedeutung des aufgestellten Tatbestandsmerkmals als Kontrollmaßstab ist damit so weit reduziert, dass das Bundesverfassungsgericht praktisch nicht mehr in die Lage kommen kann, die Einschätzung des Bundeskanzlers (genauer: das Ergebnis der präsidentiellen Überprüfung dieser Einschätzung, und damit mittelbar auch diese Einschätzung selbst sowie das Abstimmungsergebnis im Bundestag) für falsch erklären zu müssen.
- 221
Die jetzt getroffene Entscheidung macht das noch deutlicher als die vorausgegangene Entscheidung zur Bundestagsauflösung nach der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers Kohl, indem sie ausdrücklich auch die Berufung auf "verborgene" und "ihrer Natur nach" nicht in einem gerichtlichen Verfahren darstellbare Formen des Konflikts - kurz: auf eine "verdeckte" Minderheitslage - ohne weitere Offenlegungsanforderungen für ausreichend erklärt. Ein Tatbestandsmerkmal, dessen Erfülltsein hinreichend dadurch belegt werden kann, dass man auf Verdecktes, Verborgenes und seiner Natur nach vor Gericht nicht Darstellbares verweist, führt nur noch eine juristische Scheinexistenz.
- 222
Die rechtlichen Maßstäbe scheinen damit im Vergleich zu denen der Vorgängerentscheidung gelockert. Der Sache nach waren sie aber bereits im Urteil von 1983 auf Durchlässigkeit angelegt. Dass der Einschätzungsspielraum des Bundeskanzlers erst an der Grenze eindeutiger Vorzugswürdigkeit einer gegenteiligen Einschätzung ende, steht bereits in diesem Urteil (vgl. BVerfGE 62, 1 <51>). Schon damit hat das Gericht sich in der Prüferrolle, die es sich mit der Aufstellung einer ungeschriebenen materiellen Tatbestandsvoraussetzung des Art. 68 GG zugewiesen hatte, gleich wieder außer Gefecht gesetzt. Was sollte den Bundespräsidenten und das Bundesverfassungsgericht jemals in den Stand setzen, festzustellen, die von einem Bundeskanzler abgegebene Einschätzung, er könne stetiger parlamentarischer Unterstützung und damit eigener Handlungsfähigkeit nicht mehr sicher sein, sei eindeutig falsch, die vom Kanzler vermisste verlässliche Unterstützungsbereitschaft des Bundestages also eindeutig vorhanden?
- 223
Nach Einschätzung der Antragsteller stehen die Koalitionsfraktionen, in den Worten der Antragstellerin zu I., hinter dem Bundeskanzler wie eine deutsche Eiche. Nach Einschätzung des Bundeskanzlers ist dies aber gerade nicht der Fall. Der Dissens betrifft damit die Frage, ob die "wirkliche" Vertrauenslage im Parlament dem Abstimmungsergebnis vom 1. Juli 2005 entspricht oder nicht. Dass die Frage, wer hier recht hat, einem Eindeutigkeit erzeugenden Beweis nicht zugänglich ist, liegt nicht daran, dass hier Vertraulichkeitsinteressen gewahrt oder politische Beziehungen geschont werden müssten, sondern daran, dass die Frage überhaupt keinen feststellungsfähigen Sachverhalt zum Gegenstand hat (zu Widersprüchlichkeiten der Entscheidung von 1983 in diesem Punkt bereits Seuffert, AöR 108 <1983>, S. 403 <406>).
- 224
Mit der Bedeutung, die das Bundesverfassungsgericht dem Art. 68 GG zuschreibt, sind daher bloße Inszenierungen fehlender Verlässlichkeit der Bundestagsmehrheit nicht wirksam zu bekämpfen. Erst die Auslegung, nach Art. 68 GG genüge es nicht, dass der Antrag des Bundeskanzlers keine Kanzlermehrheit finde, droht im Gegenteil solche Inszenierungen hervorzurufen (vgl. Grote, DuR 1983, S. 26 <27 f.>) und erzeugt in einem Sachbereich, in dem naturgemäß nur vermutet werden kann, systematisch den Eindruck verfassungswidriger Inszenierung und deren rückgratloser Absegnung durch andere Verfassungsorgane. Den Stabilitätsinteressen, auf die das Gericht sich für diese Auslegung beruft, dürfte das abträglicher sein als jede vorgezogene Neuwahl. Versuche, dem durch strengere Anforderungen an den Beleg eingetretenen Vertrauensverlusts entgegenzuwirken (s. z.B. Gussek, NJW 1983, S. 721 <724>), können an dieser Anfälligkeit für Inszenierung und Inszenierungsverdacht nichts ändern; sie kommen eher dem Vorschlag gleich, die Regieanweisung zu verkomplizieren.
- 225
Da Neuwahlabsichten des Kanzlers keinen Aufschluss darüber geben, ob das gegenwärtige Parlament mehrheitlich zur Unterstützung der Politik des Kanzlers gewillt ist oder nicht, hat auch die noch restriktivere Annahme, zulässig und "echt" sei eine Vertrauensfrage nur, wenn sie auf Bestätigung ziele, nichts für sich. Diese Auffassung hat das Gericht daher schon früher mit Recht zurückgewiesen (vgl.BVerfGE 62, 1 <38>; s. auch Herzog, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 68 Rn. 24; Klein, ZParl 1983, S. 402 <404 f.>; Schneider , JZ 1973, S. 652 <655>).
- 226
4. Nichts hindert das Bundesverfassungsgericht daran, die unausfüllbare Kontrollfunktion zurückzuweisen, die ihm mit der Ergänzung des Art. 68 GG um eine ungeschriebene materielle Tatbestandsvoraussetzung zufällt. Keines der Argumente, die für diese Auslegung angeführt worden sind, ist zwingend.
- 227
Art. 68 Abs. 1 Satz 1 GG knüpft die Möglichkeit, den Bundestag aufzulösen, daran, dass ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages findet. Der Wortlaut dieser Bestimmung enthält nichts, was die Annahme stützt, die Befugnis des Bundespräsidenten zur Bundestagsauflösung hänge nicht nur von der Abstimmung des Parlaments über den Antrag des Bundeskanzlers, sondern von zusätzlichen Voraussetzungen ab.
- 228
Dass der Wortlaut des Art. 68 GG insoweit unergiebig ist, hat das Bundesverfassungsgericht schon 1983 richtig festgestellt (vgl.BVerfGE 62, 1 <36, 38> ; für die herrschende Meinung in der Literatur siehe Epping, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd. 2, 4. Aufl. 2000, Art. 68 Rn. 13 f.; Oldiges, in: Sachs, GG, 3. Aufl. 2003, Art. 68 Rn. 16; Hermes, in: Dreier, GG, Bd. 2, 1998, Art. 68 Rn. 10; Püttner, NJW 1983, S. 15 <16>; Liesegang, NJW 1983, S. 147 <148>; Geiger, JöR 33 <1984>, S. 41 <49, 51>; a.A. Rinck, abweichende Meinung zuBVerfGE 62, 1, ebd. S. 70 <71> ; Mager, in: von Münch/Kunig, GG, Bd. 2, 5. Aufl. 2001, Art. 68 Rn. 15; Delbrück/Wolfrum, JuS 1983, S. 758 <761>; Hochrathner, Anwendungsbereich und Grenzen des Parlamentsauflösungsrechts nach dem Bonner Grundgesetz, 1985, S. 61, 65 f.).
- 229
Die Formulierung des Art. 68 GG besagt nicht, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage nur mit dem Ziel stellen darf, das Vertrauen zu erlangen. Aus dem Begriff des Antrags folgt nicht, dass Anträge nur mit dem Ziel der Erlangung einer antragsgemäßen Entscheidung gestellt werden dürften. Es gibt auch keinen allgemeinen Rechts- oder Verfassungsgrundsatz dieses Inhalts. Aus der Tatsache, dass Art. 68 GG das Wort "Vertrauen" verwendet, lässt sich daher nicht schließen, dass der Bundeskanzler den Antrag, ihm das Vertrauen auszusprechen, nur stellen darf, oder dass der gestellte Antrag nur dann ein Antrag auf Vertrauensbekundung ist, wenn dahinter keine auf Neuwahl gerichteten Absichten stehen. Eine dahin gehende Auslegung wäre auch mit dem Risiko verbunden, nur eine Verschleierung solcher Absichten zu bewirken.
- 230
Der Wortlaut des Art. 68 GG spricht danach, um es deutlicher zu sagen, gegen die vom Bundesverfassungsgericht gewählte Auslegung, denn er enthält das vom Gericht hinzuinterpretierte Tatbestandsmerkmal nicht.
- 231
5. Auch die systematischen, historischen und teleologischen Gründe, mit denen die Anreicherung des Art. 68 GG um dieses Tatbestandsmerkmal in Rechtsprechung und Literatur gerechtfertigt wurde, können nicht überzeugen.
- 232
Die Systematik des Grundgesetzes liefert für eine einschränkende Auslegung des Art. 68 GG keinerlei Anhaltspunkt. Die als Begründungselement häufig vorgetragene Feststellung, dass das Grundgesetz die Möglichkeit der Parlamentsauflösung nur für die Fälle des Art. 63 Abs. 4 Satz 3 GG und des Art. 68 GG vorsieht, ist richtig, eignet sich aber nicht als Argument für eine bestimmte Auslegung dieser Vorschriften. Die weitergehende Feststellung, allein in diesen Fällen eröffne das Grundgesetz "unter engen verfahrensrechtlichen und materiell-rechtlichen Voraussetzungen" den Weg der Auflösung (BVerfGE 62, 1 <41>), setzt voraus, was zu begründen wäre.
- 233
Dasselbe gilt für Argumente, die sich auf die in Art. 39 GG vorgesehene Dauer der Wahlperiode stützen. Nach Art. 39 Abs. 1 Satz 1 GG wird der Bundestag auf vier Jahre gewählt, dies aber "vorbehaltlich der nachfolgenden Bestimmungen", die unter anderem den Fall der Bundestagsauflösung betreffen. Für die Interpretation der Vorschriften, die die Voraussetzungen einer Auflösung des Bundestages regeln, gibt das nichts her (vgl. auch Geiger, JöR 33 <1984>, S. 41 <46>). Die Leitidee der restriktiven Auslegung des Art. 68 GG, das Grundgesetz suche für die vierjährige Dauer der Legislaturperiode eine Art Durchhaltezwang zu institutionalisieren, den Art. 68 GG nur im Falle einer anders nicht bewältigbaren Krise zu durchbrechen erlaube (grundlegend von Mangoldt, DÖV 1950, S. 697 <699 u. passim>), ist auch deshalb erstaunlich, weil eine zu Neuwahlen entschlossene Bundestagsmehrheit im Zusammenspiel mit dem Bundeskanzler nicht daran gehindert werden kann, ein Auflösungsrecht des Bundespräsidenten auf dem Weg über den Rücktritt des Kanzlers (Art. 63 GG) herbeizuführen (vgl. auch Heun, AöR 109 <1984>, S. 13 <24 f.>; Schneider, NJW 1983, S. 1529). Der aus der Sicht der restriktiven Auslegung konsequente Versuch, auch diesen Ausweg zu verschließen (Schenke, NJW 1982, S. 2521 <2526 f.>), leidet in noch offensichtlicherer Weise als die einschränkende Auslegung des Art. 68 GG daran, dass diese Rechtsauffassung nur zum Papiertiger taugt, weil sie die Bedingungen ihrer Durchsetzbarkeit nicht berücksichtigt (vgl. auch Klein, ZParl 1983, S. 402 <413>).
- 234
Dass das Grundgesetz, in Übereinstimmung mit Äußerungen aus dem Entstehungsprozess, ein Selbstauflösungsrecht des Parlaments nicht enthält und Reformbestrebungen in diese Richtung sich bislang nicht durchgesetzt haben (vgl. Rinck, abweichende Meinung zuBVerfGE 62, 1, ebd. S. 70 <80 f.> ; aus der Literatur statt vieler Schenke, NJW 1982, S. 2521 <2523>), ist ebenfalls kein Argument für die Notwendigkeit, Art. 68 GG um Tatbestandsmerkmale zu ergänzen, die der Verfassungsgeber nicht vorgesehen hat (vgl. Schröder, JZ 1982, S. 786 <788>). Von einem Selbstauflösungsrecht des Parlaments, wie es etwa die österreichische Verfassung (Art. 29 Abs. 2 B-VG) und sämtliche deutschen Landesverfassungen vorsehen, kann auch dann keine Rede sein, wenn das angebliche ungeschriebene Tatbestandsmerkmal des Art. 68 GG aufgegeben wird, denn die Auflösung des Parlaments hängt nach dieser Bestimmung nicht allein von diesem selbst ab. Ohne eine Vertrauensfrage des Bundeskanzlers und, wenn das Parlament diese negativ beantwortet, ohne eine Entscheidung des Bundespräsidenten, die in sein Ermessen gestellt ist, findet die Auflösung nicht statt. Die Tatsache, dass das Grundgesetz dem Bundespräsidenten für seine Auflösungsentscheidung ein Ermessen einräumt, spricht im Gegenteil gegen die Annahme, dass seine Ermessensfreiheit erst einsetzt, wenn neben den in Art. 68 GG ausdrücklich genannten Voraussetzungen noch weitere erfüllt sind. Stünde der Weg der Bundestagsauflösung nach einem Vertrauensantrag, der nicht die Kanzlermehrheit gefunden hat, nur unter der vom Bundespräsidenten und letztlich auch vom Bundesverfassungsgericht zu überprüfenden Voraussetzung offen, dass hinter dem Abstimmungsergebnis eine Krisenlage steht, die nicht mehr anders als durch Neuwahlen beendet werden kann, so wäre unverständlich, weshalb dem Bundespräsidenten das Ermessen eingeräumt sein sollte, in dieser Lage Neuwahlen nicht zuzulassen.
- 235
6. Die Entstehungsgeschichte des Art. 68 GG liefert eine Bestätigung für einschränkende Auslegungen nur, wenn man bekannte gegenteilige Hinweise mühsam hinweginterpretiert und weniger bekannte ganz übergeht.
- 236
Die Ablehnung, auf die im Parlamentarischen Rat der Vorschlag des Redaktionsausschusses stieß, die Möglichkeit der Bundestagsauflösung auch auf ein parlamentarisches Misstrauensvotum hin einzuräumen, belegt entgegen einer verbreiteten, auf Abwehr "plebiszitärer" Elemente ausgerichteten Interpretation (grundlegend von Mangoldt, DÖV 1950, S. 697 <698>; vgl. auch Hopfauf, AöR 108 <1983>, S. 391 <393 ff.>) nicht die Absicht, das Recht zur Bundestagsauflösung in möglichst engen Grenzen zu halten. Die dahinterstehende Absicht war vielmehr, das parlamentarische Misstrauensvotum anders als unter der Weimarer Verfassung (Art. 54 WRV) ausschließlich als konstruktives zuzulassen (Art. 67 GG), um so die unproduktiv delegitimierende Wirkung rechtsfolgenloser Misstrauensbekundungen auszuschließen (vgl. die in der 4. Sitzung des Hauptausschusses geführte Diskussion, in: Parlamentarischer Rat, Verhandlungen des Hauptausschusses, Bonn 1948/49, S. 41 <44>; zur Weimarer Geschichte der nicht konstruktiven Misstrauensvoten Brandt, Die Bedeutung parlamentarischer Vertrauensregelungen, 1981, S. 30 ff.).
- 237
Die durch mehrere Äußerungen von Abgeordneten gestützte Feststellung, dem Parlamentarischen Rat habe bei der Ausarbeitung des Art. 68 GG vor allem die Konstellation einer Minderheitskanzlerschaft vor Augen gestanden (vgl. BVerfGE 62, 1 <46>; Hopfauf, a.a.O., S. 391 <393 ff.>; Schenke, NJW 1982, S. 2521 <2523>), hilft für die Auslegung nicht weiter. Es ist nicht deutlich, was bei diesen Äußerungen unter einer Minderheitsregierung beziehungsweise einem Minderheitskanzler verstanden wurde. Sollte der Begriff technisch gemeint, also der Fall eines nicht von der Mehrheit des Bundestages gewählten ernannten Kanzlers (Art. 63 Abs. 4 Satz 2 GG) angesprochen gewesen sein (so offenbarBVerfGE 62, 1 <46> ), dann verband sich mit der wiederholten Hervorhebung dieses Sonderfalles offensichtlich nicht die Vorstellung, Art. 68 GG solle allein diesen speziellen Fall erfassen (so auch BVerfG, a.a.O.). Es war unbestritten, dass Art. 68 GG jedenfalls ganz allgemein einen Ausweg für den Fall bereitstellen sollte, dass der Kanzler, gleich ob von vornherein oder erst aufgrund nachträglich eingetretener Entwicklungen, die "Mehrheit nicht hinter sich" hat (vgl. die Äußerung des Abgeordneten Dr. Dehler in der 25. Sitzung des Organisationsausschusses, in: Der Parlamentarische Rat 1948 - 1949, Akten und Protokolle, Bd. 13, Teilband 2, 2002, S. 868). Auch wenn man davon ausgeht, dass die Begriffe des Minderheitskanzlers und der Minderheitsregierung im Parlamentarischen Rat untechnisch in dem Sinne verwendet wurden, dass sie allgemein auf diesen letzteren Fall gemünzt waren, gibt die wiederholte Hervorhebung dieses Falles noch keinen Aufschluss über das richtige Verständnis des Art. 68 GG. Es zeigt sich darin nur, dass dieser Fall der gedankliche Anlassfall für die Schaffung der Bestimmung war. Die entscheidende Frage, ob man es für wünschenswert, möglich und sinnvoll hielt, die Nutzung dieser Bestimmung rechtlich kontrollierbar auf den gedanklichen Anlassfall zu beschränken, ist damit nicht beantwortet. Dagegen spricht nicht nur die Wortfassung des Art. 68 GG, die in diesem Punkt, wenn man denn gewollt hätte, problemlos deutlicher hätte gefasst werden können. Auch eine Reihe von Diskussionsbeiträgen in den Beratungen des Parlamentarischen Rates geben gegenteiligen Aufschluss.
- 238
Der Abgeordnete Dr. Katz - später Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts - erklärte in der 4. Sitzung des Hauptausschusses, bei Art. 68 GG (Art. 90a der damaligen Entwurfsfassung) handele es sich "um die Möglichkeit, der Bundesregierung im Falle eines ernsthaften politischen Konflikts oder für den Fall, dass die Bundesregierung den Wunsch hat, eine wichtige politische Frage durch das Volk entscheiden zu lassen, ein Auflösungsrecht zu schaffen" (in: Parlamentarischer Rat, Verhandlungen des Hauptausschusses, Bonn 1948/49, S. 41 <44>). Hier wird ganz deutlich, und unwidersprochen, neben dem Fall eines ernsthaften politischen Konflikts alternativ auch der Wunsch der Bundesregierung, eine Entscheidung durch das Volk herbeizuführen, als möglicher Anlass für die Vertrauensfrage genannt. Diese Äußerung fiel nicht en passant an unwichtiger Stelle; sie diente der Erläuterung des Entwurfs des Art. 90a GG, den Katz soeben im Namen seiner Fraktion dem Ausschuss unterbreitet hatte, den der Ausschuss anschließend mit 16:2 Stimmen annahm und der ohne sachlich relevante Änderung als Art. 68 GG Gesetz wurde. Ebenfalls unwidersprochen blieb die Feststellung desselben Abgeordneten in der 33. Sitzung des Hauptausschusses, "Sinn des Artikel 90a" sei es, "der Regierung die Chance einer Neuwahl zu geben, wenn sie es für gegeben erachtet" (a.a.O., S. 403 <415>) - ein deutlicher Hinweis darauf, dass an ungeschriebene materielle Voraussetzungen, anhand deren der Bundespräsident oder gar das Bundesverfassungsgericht das "Erachten" des Bundeskanzlers zu überprüfen haben würde, keineswegs gedacht war.
- 239
Diesen beiden klaren Äußerungen ist in der Literatur die schon besprochene wiederholte Bezugnahme von Abgeordneten auf die Situation des - an anderer Stelle auch von Katz selbst erwähnten - Minderheitskanzlers entgegengehalten worden. Darauf wurde die Schlussfolgerung gestützt, auch die zitierten Äußerungen bezögen sich ungeachtet ihres Wortlauts nur auf den Fall des Minderheitskanzlers (s. vor allem die ausführliche Untersuchung der Entstehungsgeschichte bei Hopfauf, AöR 108 <1983>, S. 391 <393 ff., 398>; offenlassendBVerfGE 62, 1 <46> ). Dass man sie wörtlich und für die Auslegung des Art. 68 GG ernst zu nehmen habe, wurde außerdem mit dem Argument für unwahrscheinlich gehalten, Art. 68 GG würde dann zu einem plebiszitären Element im ansonsten bewusst repräsentativ konzipierten Grundgesetz (Hopfauf, a.a.O., S. 391 <400>; vgl. auch von Mangoldt, DÖV 1950, S. 697 ff.; zum Gebrauch des Wortes "plebiszitär" im Zusammenhang mit Art. 68 GG vgl. Zeh, ZParl 1983, S. 119 <125>). Eine weitere Bemerkung, die in der juristischen Diskussion des Art. 68 GG vernachlässigt worden ist, zeigt allerdings, dass Katz durchaus wusste, was er sagte. In der Beratung des Hauptausschusses über die Einführung von Volksentscheiden wandte er sich gegen deren Notwendigkeit unter anderem gerade mit dem Hinweis auf Möglichkeiten, die bereits Art. 68 GG biete: "Der Volksentscheid ist nicht ein unentbehrlicher Bestandteil der Demokratie. Der Wähler wählt alle paar Jahre, alle vier Jahre und, wenn vorher eine Auflösung kommt, schon vorher. Wenn wichtige Fragen strittig sein sollten, wird die Auflösung des Bundestags herbeigeführt" (Protokoll der 22. Sitzung, in: Parlamentarischer Rat, a.a.O., S. 255 <264>; vgl. auch Niclauß, APuZ 1992, S. 3 <14>).
- 240
Die einschränkende Auslegung des Art. 68 GG findet demnach entgegen der Auffassung des Senats auch in der Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes keine Grundlage.
- 241
7. Art. 68 GG ist, wie der Senat mit Recht feststellt, Bestandteil eines auf Stabilität ausgerichteten Normgefüges, für dessen Konzeption die Berufung auf Weimarer Erfahrungen eine wesentliche Rolle spielte. Dass gerade die Kontrollfassade, die das Bundesverfassungsgericht mit einer für Inszenierungen und Inszenierungsverdacht anfälligen Auslegung des Art. 68 GG aufrichtet, dem Stabilisierungszweck dient, ist aber selbst dann nicht sicher, wenn man Stabilität am besten dadurch gewährleistet glaubt, dass möglichst selten Wahlen stattfinden.
- 242
8. Wenn das Recht Forderungen aufstellt, gegen deren Umgehung oder scheinhafte oder herbeiinszenierte Erfüllung es nichts aufzubieten hat, befördert es nicht gute Ordnung, sondern Simulation oder sogar die Herbeiführung gerade dessen, was vermieden werden soll. Für den Eindruck des Unlauteren, den die Praxis unter solchen rechtlichen Rahmenbedingungen erwecken kann, und für das Misstrauen gegen die Institutionen und die ordnende Kraft des Rechts, das sich dann zwangsläufig ergibt, macht man besser die verfehlten Rechtsbedingungen verantwortlich als diejenigen, die unter diesen Bedingungen zu agieren haben. Denn die verfehlten Rechtsbedingungen sind das Einzige, was sich hier mit Aussicht auf Erfolg ändern lässt. Die angeblich vom Zweck des Art. 68 Abs. 1 Satz 1 GG diktierte materielle Tatbestandsvoraussetzung, die Außenstehende zum Richter über die Existenz politischen Vertrauens im Parlament macht, ist eine verfehlte Rechtsbedingung. Aus den genannten Gründen bin ich der Auffassung, dass sie in der Verfassung keine Grundlage hat.
- 243 Lübbe-Wolff
September: September